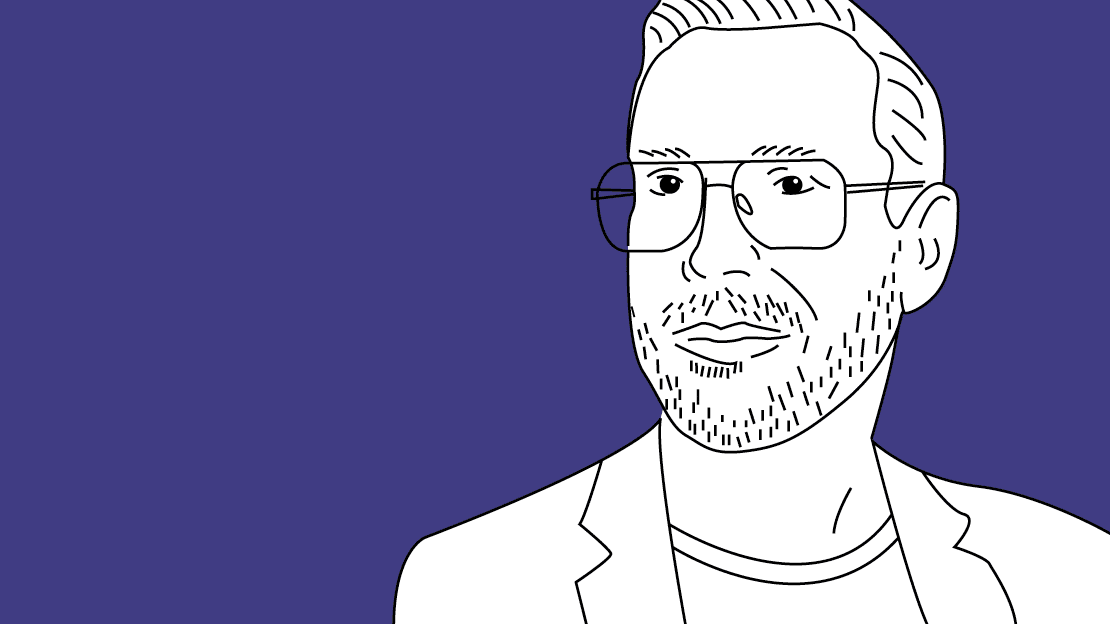
Am vergangenen Freitag, den 20. September 2019, hat die Quadriga Hochschule Berlin zum achten Mal den Digital Communication Award verliehen. Als Jurymitglied hat Quadriga-Professor Alexander Gutzmer viele spannende Einreichungen bewertet – und sich im Nachgang einige grundsätzliche Gedanken zur Ökonomie von Awards gemacht.
Im Jahr 1972 veröffentlichten die amerikanischen Volkswirte W. Lee Hansen und Burton Weisbrod ein Paper. Ein solides Paper, mit ökonomischer Argumentationsweise und akademischer Sprache, smart, ein bisschen verkopft vielleicht – wie Makroökonomen eben so schreiben. Vermutlich wären die beiden heute sehr senioren Herren überrascht, wenn ich ihnen sagen würde, dass sie quasi die Vordenker eines der wichtigsten Performance- und Party-Phänomens des 21. Jahrhunderts waren: dem, was man, mit einiger publizistischer Freiheit, mal als die „soziale Ökonomie der Awards“ bezeichnen könnte.
Von den Oscars zu den Digital Communication Awards – von French Connection zu #LikeABosch
Denn darum ging es Hansen und Weisbrod: Warum gibt es eigentlich Awards, fragten sie in ihrem Paper. Eine „general theory of awards“ wollten sie entwickeln, auf Basis der diversen Preise für Ökonomen, die es zu jener Zeit bereits gab. Offenbar entwickelten in den 1970ern die damaligen Großdenker ökonomischer Zusammenhänge eine besondere Freude an Auszeichnungen aller Art. Aber natürlich gab es damals auch schon diverse weitere Awards in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Die Oscars zum Beispiel.
Den Oscar für den besten Film holte in jenem Jahr übrigens William Friedkins „French Connection“. Ein phantastischer, mutiger Film. Hart, arty, mit einer der besten Car-Chase-Szenen der Filmgeschichte.
Wenn also Hansen und Weisbrod schon vor Jahrzehnten über die Bedeutung, man könnte auch sagen den Wert von Awards nachdachten, und wenn zugleich in Hollywood mutiges Kunstkino belohnt wurde – so könnte man doch die These aufstellen, dass Awards vielleicht wirtschaftlich eine ziemlich produktive, womöglich sogar eine gesellschaftliche Rolle spielen. Wenn das so wäre, dann würde es auch bedeuten, dass die vielen Stunden Grübeln, Präsentieren und Debattieren, die ich mir vergangene Woche gemeinsam mit vielen anderen Pitchern und Juroren im Rahmen der diesjährigen „Digital Communication Awards“ der Quadriga Hochschule Berlin gegeben habe, nicht ganz umsonst gewesen sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie das waren.
Schon deshalb nicht, weil wir als Jury schlicht ziemlich viel Spannendes und Innovatives gesehen haben. Und ich habe auch manches gelernt. Zum Beispiel, dass bei aller Ideenbrillanz jede Kampagne sich weiterentwickelt und daher ein Stück Flexibilität braucht. So haben zum Beispiel die Macher des diesjährigen Viral-Megahits „Like a Bosch“ kontinuierlich an ihrer Kampagne weiter geschraubt, neue Akzente gesetzt, Schwerpunkte verschoben. Dafür wurde „Like a Bosch“ in Berlin als Sieger der Kategorie „Campaign of the Year – Companies“ ausgezeichnet.
Juroren-Tätigkeit als Selbstcheck – Viele Unternehmen zeigen Haltung im digitalen Raum
Insgesamt ist die Arbeit als Juror ein guter Check-Up, ob man aktuelle Trends in der Kommunikation und in den Haltungen von Agenturen und Unternehmen eigentlich noch richtig beurteilt. Und der Begriff „Haltung“ kommt hier nicht von ungefähr. Denn um genau diese ging es bei vielen der präsentierten Digital-Kommunikationsansätze. Es ist offensichtlich: Viele Unternehmen ringen um eine eigene Position zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Die Gleichberechtigung beispielsweise wird von vielen Kampagnen entweder zum zentralen Inhalt gemacht oder implizit mit adressiert.
Auch für LGBT+-Rechte setzen sich manche Unternehmen ein, und das oft auch wirklich ernsthaft und ohne Rücksicht auf den möglichen Verlust von Kunden. So ist es schon eine mutige Kampagne, die Ikea Italien unter dem Titel #DoItAtYourHome fährt. „Mach das zu Hause“ nämlich schallt es vielen Italienern in der Öffentlichkeit entgegen, wenn ihre Art zu Lieben nicht der konservativen Norm entspricht. Hier hält Ikea dagegen: „Home“ ist, wo auch immer Du bist. Mutig ist das auch deshalb, weil das Unternehmen seine eigene Kernsphäre, die eigenen vier Wände nämlich, damit bewusst verlässt. In Berlin gab es dafür den Preis in „CSR Communications“.
Awards zeigen die Kriterien „guter“ digitaler Kommunikation – Strategie geht vor Klicksammeln
Es lohnt sich, auf die Liste alle Preisträger zu schauen und spannende Cases nochmal zu googeln. Denn dies liefert nicht nur ein gutes Bild der kreativsten Ansätze in Sachen digitaler Kommunikation. Es produziert auch einen Eindruck davon, anhand welcher Kriterien „gute“ Kommunikation heute und in näherer Zukunft verhandelt wird. So schien mir zum Beispiel der Fokus in diesem Jahr wieder stärker auf langfristiger Strategie zu liegen, nicht so sehr auf kurzfristorientiertem Klicksammeln. Und die mich immer ein wenig nervende Tendenz von vielen Agenturen, den eigenen Case nicht selber zu erklären, sondern durch ein Talking-Head-Video erklären zu lassen, kommt offenbar auch an ihr Ende – dem Digitalhimmel sei Dank.
So weit ein paar Impressionen von mir. Der von Hansen und Weisbrod geforderten „general theory of awards“ kommen wir damit natürlich nicht näher. Und wenn meine oberflächliche Online-Literaturrecherche richtig liegt, steht diese tatsächlich noch aus. Vielleicht hat ja der eine oder die andere aus meinem Professorenkollegium Lust? Ansonsten sollten wir es vermutlich einfach mit einem anderen Award-Experten (weil -Abräumer) halten, mit Freddy Mercury: The show must go on. And it will go on. See you next year.
Literatur: W. Lee Hansen und Burton Weisbrod: Toward a General Theory of Awards, or, Do Economists Need a Hall of Fame? In: Journal of Political Economy 80.2, S. 422-431

Seit 2013 ist Alexander Gutzmer Professor für Medien und Kommunikation an der Quadriga Hochschule Berlin. Von 2017 bis 2018 war er darüber hinaus Gastprofessor an der mexikanischen Business School Tecnológico de Monterrey. Der promovierte Kulturwissenschaftler und Diplom-Betriebswirt arbeitete außerdem als Editorial Director und Erster Journalist des Hauses beim Münchner Callwey-Verlag. Dort verantwortete er die Architekturzeitschrift Baumeister und die englischsprachige Zeitschrift für Urban Design und Stadtentwicklung Topos. Nun ist er Direktor Marketing & Kommunikation des Münchner Immobilienentwickler Euroboden. Gutzmer wurde am Londoner Goldsmiths College (University of London) als Doctor of Philosophy promoviert. Er studierte Kulturwissenschaften (ebenfalls am Goldsmiths College) sowie zuvor BWL (an der FU Berlin und der Warwick Business School). Den Einstieg in den Beruf des Journalisten fand er in der Redaktion der Welt am Sonntag.









